STARTSEITE I AKTUELLES I PETER MARGGRAF I BILDHAUER UND ZEICHNER I SAN MARCO HANDPRESSE I VENEDIGPROJEKT I KONTAKT
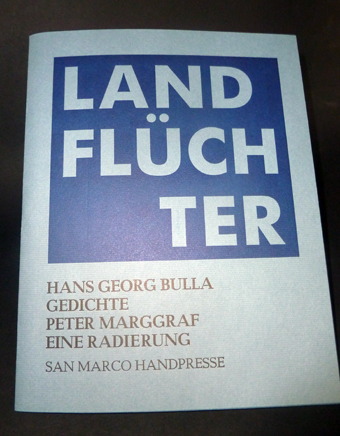 |
 |
Das Licht im Schatten
Gedichte von Hans Georg Bulla mit
einer Radierung
von Peter Marggraf im
bibliophilen Band „Landflüchter“
Isabel Kobus
Am 20. Juni 2019 ist Hans Georg Bulla 70
Jahre alt geworden. Zeitgleich hat Peter Marggraf in der San Marco
Handpresse die neuen Gedichte des großen niedersächsischen Lyrikers
herausgegeben: Der bibliophile, großformatige Band „Landflüchter“
ist im Sommer 2019 in 24 Exemplaren und vier zusätzlichen
Künstlerexemplaren erschienen. Das klare Schriftbild in
12-Punkt-Candida, in bewährter Marggrafscher Qualität auf der
Linotype gesetzt, mit dem Handtiegel auf Büttenpapier gedruckt und
mit höchster Sorgfalt gebunden, harmoniert mit der einfachen und
klar strukturierten Form der Gedichte ebenso wie die Radierung mit
dem Titel „Im blauen Schatten“, die Peter Marggraf jedem Band
beigelegt hat und auf die noch näher einzugehen sein wird.
Als den „Dichter, der die Stille
aufschreibt“ bezeichnet Bert Strebe den Jubilar in seiner Würdigung
zu Hans Georg Bullas 70. Geburtstag. Stille Melancholie und die
Fähigkeit, Stimmungen in schlichte, aber höchst präzise Worte zu
fassen und damit ungewöhnliche und doch eingängige Bilder zu
schaffen, waren schon immer wesentliche Eigenschaften des Lyrikers
Hans Georg Bulla, und sie sind es heute noch. Doch in seinem neuen
Band findet sich auch Überraschendes – neue Töne, die deutlich
machen, daß Hans Georg Bulla zwar 70, aber noch lange nicht alt ist.
Den Gedichten in „Landflüchter“ stellt
Bulla ein Zitat des schwedischen Dichters und
Literatur-Nobelpreisträgers Tomas Tranströmer voran: „Im Gelände
draußen, nicht weit von der Ansiedlung, / liegt seit Monaten eine
vergessene Zeitung voller Ereignisse. / Sie altert Nächte und Tage
hindurch in Regen und Sonne, / dabei, eine Pflanze zu werden, ein
Kohlkopf, dabei, mit dem Boden eins zu werden. / So wie eine
Erinnerung sich langsam zu dir selbst verwandelt.“
Das Zitat paßt so gut zu Bullas neuer
Gedichtsammlung, daß man meinen könnte, es sei dafür geschrieben.
Die Themen „Vergessen und Erinnerung“ sind stets gegenwärtig in den
vorliegenden Gedichten, ebenso aber auch die Verwandlungen, die
Tranströmer in ähnlich schlichten, aber eingängigen Bildern
ausdrückt, wie Hans Georg Bulla das in seiner Lyrik vermag: Die
Zeitung wird zur Pflanze, das Geschehene zu Erde, die Natur nimmt
sich all das, was für uns Menschen einst so wichtig schien. Zugleich
aber bleibt die Erinnerung, das Abbild all der wichtigen und
scheinbar wichtigen Dinge des Lebens, im Kopf des Menschen und wird
dort Teil der eigenen Persönlichkeit, wandelt sich zum Selbst. In
der Analogie dieser Verwandlungen liegt die Verbindung des Menschen
zum Außen: Die Zeitung mit den Worten als Sinnbild des Außen und die
Erinnerung als Sinnbild des Innen sind beide in ständiger
Veränderung begriffen. Das Ziel dieser steten Veränderung aber ist
ein schicksalhaftes – Verwesung und Tod stehen beiden bevor. Dieses
Bewußtsein ist Ursache für die tiefe Einsamkeit des Menschen, die
immer wieder in Hans Georg Bullas Gedichten aufscheint – doch
zugleich zeigt es auch den Weg auf, sie zu überwinden. Die
Universalität dieser Themen läßt der Dichter im vorliegenden Band
noch deutlicher hervortreten, indem er das lyrische Personal im
Vergleich zu früheren Bänden erweitert hat. Zusätzlich zur immer
wieder aufscheinenden eigenen Innensicht wirft er Schlaglichter auf
Charaktere aus verschiedenen Lebenswelten – die Tänzerin, die
Musiker, den Süchtigen und den Prediger, Kinder, Kranke und
Gebärende.
„Baggersee“ heißt eines der schönsten
Gedichte in „Landflüchter“. In einem wie hingegossenen Bild evoziert
es ein Treffen junger Menschen am See: „Eine lange Nacht, ein
kleines / Feuer, die Flaschen im Wasser. / Wir im Kreis hockten auf
/ abgeschlagenen Stämmen (...) / das Gelächter wurde lauter“. Im
zweiten Abschnitt ist „der Transistor stumm geworden“, die
Jugendlichen begeben sich zur Ruhe: „Zwei legten sich in die /
Schlafsäkke auf den Boden, / zwei teilten sich die Matratze“. Und:
„Einer ging noch einmal / um den See und kam nicht wieder“. Ein
offenes Ende, wie in manch einem der hier versammelten Gedichte: Ob
der eine nur die Versammlung verlassen hat, ob er seinen Tod gesucht
hat im Wasser, oder ob der Schluß nur ein Verweis auf das Loslassen
scheinbar schöner Erinnerungen ist – dem Leser bleibt die Deutung
selbst überlassen. Die „lange Nacht“ jedenfalls, die anschaulich
heraufbeschworene Gemeinschaft jugendlichen Vergnügens, erweist sich
als ebenso vergänglich, vielleicht illusionär, wie das Schriftbild
der verwesenden Zeitung in Tranströmers Zitat.
Auffällig jedoch
ist der Bruch in diesem Gedicht, der härter ist als manches, das man
aus früheren Bulla-Gedichten gewohnt ist. Dergleichen ist in diesem
Band auch anderweitig zu finden. So fliegt in „Im Juli“ am Ende ein
Vogel gegen „das blinkende Fenster“ / „in ein gläsernes Feuer“. Zwar
ist die Störung, das Beängstigende in diesem Gedicht schon am Anfang
angekündigt, als ein Hubschrauber und eine Sirene „eine Schleppe aus
Lärm“ über den Garten ziehen, doch im Mittelteil sorgt die Katze –
wie immer ein beliebter Gast in Bullas Gedichten – für die Illusion,
zumindest in der Natur sei alles in Ordnung – sie „streicht langsam
/ an den gestapelten Brettern / vorbei in ihr Versteck“.
Der Tod des
Vogels im „gläserne[n] Feuer“ des sonnenbeschienenen Fensters ist
ein ungewöhnlich verstörendes Bild für Hans Georg Bulla.
Irritierender noch präsentiert sich das erste Gedicht des Bandes,
„Der Nachen“: Eine nicht näher definierte Gruppe von Menschen, als
„wir“ bezeichnet, treibt in einem Nachen durch Brackwasser, hört das
Heulen der Hunde, „je ferner desto lauter“, bis schließlich ein
grauer Bug vor ihnen auftaucht, er „teilte das Wasser, / den Nachen
und uns.“ Die bedrohliche Stimmung und das rätselhafte Ende – wie
kann ein Nachen geteilt werden und wie kann es, nach einer solchen
Teilung, noch ein „uns“ geben? – setzen Zeichen für diesen Band, in
dem Bulla immer wieder auch Verstörendes in Worte faßt, ohne dabei
aus seinem kunstvoll-schlichten Sprachduktus herauszufallen.
Brillant und in einfachen Worten
verbildlicht Hans Georg Bulla beispielsweise die unscharfe Grenze
zwischen Grausamkeit und Unschuld in „Februar, auf dem Hof“: Nach
dem Schlachten bekommt das als „du“ angesprochene Kind eine
Schweinsblase als Ball, mit trockenen Erbsen darin: „Du wirfst ihn
rasselnd hoch / in die kalte Luft, / ein voller Mond / steht früh am
Himmel.“ Das Organ des geschlachteten Tieres wird zum Spielball des
Kindes, dessen Gefühle das Gedicht nicht thematisiert. Der volle
Mond gleicht in seiner runden Form dem Ball, zugleich kontrastiert
seine romantische Evokation aufs Schärfste mit der rasselnden
Schweinsblase. Wie schon in „Im Juli“ treten hier Mensch und Natur
in ein dynamisches Verhältnis miteinander, sie könnten Opfer sein
oder Täter, sie haben keine Wahl – alles geschieht mit
schicksalhafter Stringenz.
Das Dramatische des Schicksalhaften, wie
es sich schon im Prozeß der Verwesung und Verinnerlichung im
Tranströmer-Zitat andeutet, spielt in „Landflüchter“ eine erhebliche
Rolle, und manche dieser Gedichte sind kurz gefaßte Geschichten von
komplexer Tragik. „Vater aus dem Krieg“ läßt in 14 Zeilen in voller
Wucht die innere Entfremdung einer Familie vor dem Auge des Lesers
erstehen: Der Vater, vom Lager zurück, schreit im Schlaf
unverständliche Wörter, morgens sitzt er stumm mit seiner Frau beim
Frühstück, und am Ende „(...) ging sie, weckte den Jungen“ – das
Trauma des Krieges, so ahnt man, wird hier auf einen unschuldigen
jungen Menschen übertragen. Ebenso wie der Vater nachts nichts mehr
von seinen Schreien weiß, ist das nächtliche Drama seiner Eltern
nicht ins Bewußtsein des Jungen gedrungen – und doch ist es seines,
er hat die Schreie und das Schweigen im Schlaf aufgesogen, er kann
diesen Eltern nicht entfliehen, die ihrerseits in ihrem Leben
gefangen sind. Auch und gerade die nicht bewußte Erinnerung wird zum
Selbst.
Das harte Schicksal der Kinder in vergangenen Zeiten ist immer
wieder Thema in Bullas neuen Gedichten – das Baby in „Neugeboren“
wird nicht alt werden, und „Damals im Heim“ kratzten die Decken auf
den blanken Armen, Gespött und Gelächter treffen den, der die Hose
herunterlassen muß vor dem „blonden Fräulein.“ Nicht weniger hart
trifft es die alten Menschen in diesem Band. Doch mit einem
wesentlichen Unterschied: Während die Kinder keine andere Wahl haben
als sich ihrem Schicksal zu ergeben, finden die alten Menschen Wege,
mit ihren Erinnerungen wie auch mit der Bedrohung durch Schwäche und
Tod umzugehen. Die „Alte Tänzerin“ holt sich zwar blaue Flecken,
wenn sie beim Tanz an Tischkante oder Schrankecke anstößt, doch die
beeindrucken sie nicht, denn „sie will nicht, daß etwas / ihr im Weg
war, als sie sich / eben drehte, drehte um die / eigne Achse.“ Ihr
Wille läßt sie nicht ruhen, ungeachtet der schmerzhaften Realität –
und die Erinnerung an ihre einstmaligen Fähigkeiten ist ihr zum
Selbst geworden, von dem sie nicht lassen kann, um das sie immer
wieder unbeirrbar kreist.
Der Sterbende in „Sein letzter
Geburtstag“ hingegen will nach außen dringen, die Welt umfassen:
Einen Globus wünscht er sich, der von innen leuchtet, um den will er
seine Hände legen und „die Naht spüren, die / die Hälften
zusammenhält.“ Und das lyrische Subjekt in „Die Alleinesserin“
vergißt zwar das Essen auf dem Herd und hat den Koffer an der Tür
stehen, falls sie eilig fort muß – aber: Sie stellt Blumen auf den
Tisch, streicht die Decke glatt und stellt „einen zweiten Teller
dazu.“ Damit hat sie einen Weg aus den Dunkelheiten des Lebens
gefunden: das Miteinander mit einem anderen Menschen.
Das Miteinander ist ein wesentliches
verbindendes Element nicht aller, aber doch einer erheblichen Anzahl
von Gedichten in diesem Band. Und es setzt ein Zeichen jenseits der
Verstörung, das über das einführende Tranströmer-Zitat hinausweist.
Denn auch wenn Werden und Vergänglichkeit eins sind im Inneren wie
im Äußeren, so unterscheidet den Menschen doch eines von den Dingen
seiner Umwelt: seine Fähigkeit zum Miteinander, zur Liebe. An der
Gesellschaft anderer mag der Mensch scheitern, so wie am
„Baggersee“, oder sie mag Illusion bleiben wie in „Die
Alleinesserin“ oder in dem traurigen kleinen Gedicht „Schwimmen im
Meer“, in dem das lyrische Ich noch im Untergang einer Gestalt am
Strand zuwinkt, von der er wohl weiß, daß es sie nicht gibt.
Doch wo die
Gemeinschaft tatsächlich geschieht, ist sie Trost, vielleicht sogar
Rettung. So wie in „Durchs Moor“, als das radfahrende „Du“ stürzt,
das „Ich“ ihm aufhilft, und „wir lagen uns / dann in den Armen.“
Oder wenn in „Ende des Sommers“ die sterbende Katze noch einmal in
die Augen ihrer Menschen blickt, die ihr „noch ein paar / helle Tage
verschafft“ haben. Oder wenn das „Alte Paar“ im gleichnamigen
Gedicht gemeinsam auf die Schläge der eigenen Herzen hört – die
ausgelesene Zeitung wird, anders als im Tranströmer-Zitat, hier vom
Wind ergriffen, die Welt bewegt sich, die Erinnerung verweht, doch
das Paar bleibt sitzen: „Ein ganzes Leben / hat gereicht / den Platz
zu finden“. Und so können sogar die losgelassenen Erinnerungen zum
Trost werden, wenn sie einen geliebten Menschen evozieren. Im
letzten Gedicht, „Durchfahrt“, versinnbildlicht das Gedenken an
einen toten Freund ein Handschuh, er „ging verloren / auf dem Weg,
winkend / lag er dann auf einem / der hohen Steine.“
Bezeichnenderweise ist es hier kein lyrisches Ich, das durch die
langen Reihen der Gräber geht und den Handschuh dem Grabstein
überläßt – es ist ein lyrisches Wir.
Dem Band beigelegt hat Peter Marggraf
eine Radierung aus dem Jahr 2009 mit dem Titel „Im blauen Schatten“.
Vor dunklem Hintergrund zeigt sie eine kompakte Gestalt, die
weibliche Brüste hat, deren markanter, haarloser Kopf und deren
breite Schultern jedoch auch die Assoziation von Männlichkeit
wecken. In ihrer Haltung wirkt die Figur – eng angelegte Arme, der
Hals leicht im Körper versunken – verschlossen und in ihrer engen
Begrenzung durch den Bildrand sogar eingeschlossen, gefangen.
Zugleich wenden sich Kopf und Blick jedoch in die Ferne. Ein
angedeuteter zweiter Umriß des Kopfes deutet auf den titelgebenden
„blauen Schatten“ hin, dessen Blau in der Schwarz-Weiß-Radierung
rein symbolischen Wert hat – dieser Schatten macht zudem deutlich,
daß die helle Figur ihren Kopf in die Richtung gewendet hat, aus der
sie beleuchtet wird: Sie blickt ins Licht.
Das in einfachen Strichen gezeichnete,
aber dennoch komplexe Bild trägt ähnliche Deutungsmöglichkeiten in
sich wie die Lyrik Hans Georg Bullas in diesem Band: das
Gefangensein im eigenen, durch die Schicksalhaftigkeit des Lebens
geprägten Ich, die Melancholie der Erinnerung, zugleich aber auch
das, was darüber hinausweist – die Universalität des Menschen, der
nie allein mit sich ist, auch wenn es ihm so erscheinen mag, und
dessen Blick in die Ferne immer eine Erleuchtung in sich trägt, auch
wenn er im Schatten steht.